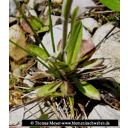Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)
Campanula patula L. 1753
Campanulaceae
- Glockenblumengewächse (APG IV)Wiesen-Glockenblume
Taxonkonzept: Schmeil-Fitschen 2019
Verbreitung: Europa, West-Sibirien
Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN
Größe: 0,3 - 0,6 (m)
Blütezeit: V - VII
Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei Zander 2008; Familie: Campanulaceae (Zander 2008)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei The Plant List (2010); Familie: Campanulaceae (APG III)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Campanulaceae (APG III)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Campanulaceae (APG IV)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei Zander 2008; Familie: Campanulaceae (APG IV)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei Rothmaler 2017; Familie: Campanulaceae (APG IV)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Campanulaceae (APG IV)Campanula patula L. - Accepted: Campanula patula L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Campanulaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))
- Blütenfarbe
- rosa-lila
- Blüten
- Krone zur Hälfte oder zu einem Drittel gespalten, Blütenstiele in der Mitte mit 2 kleinen Vorblättern, Infloreszenzen breit rispig (Blüten oft zu 90° geneigt)
- Schutzstatus, Rote Liste
- Vorwarnliste in DE (V) Ungefährdet in BW (*)
- Lebensform
- krautig, terrestrisch, zweijährig
- Bodenbedingungen
- frische, nährstoffreiche, meist kalkarme, mäßig saure bis neutrale, mehr oder weniger humose, sandige oder reine Ton- und Lehmböden
- Lichtbedingungen
- sonnig
- Lichtbedingungen (Symbole)
- ○
- Wurzeltypus
- Hauptwurzel dünn, spindelig
- Natürliches Vorkommen (Habitat)
- vor allem kurzwüchsige Fettwiesen tiferer Lagen, an Wegen, Brachen; Ebene bis mittlere Gebirgslagen, im nordwestlichen Tiefland fehlend
- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)
- häufig
- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)
- gern in etwas mageren oder gestörten Rasengesellschaften, schwache Arrhenatherion-Verbandscharakterart, in Bergwiesen nur an wärmeren Stellen, Ass. Arrhenatheretum elatioris
- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen
- nicht salzertragend
- Einschränkungen bzgl. Temperatur
- etwas wärmeliebend
- Status der Einbürgerung
- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota
- Generelle Empfehlung
- Empfohlen für die Bienenweide. Überlebensgrundlage für Sandbienen Andrena curvungula, A. pandellei, die Fruchtbiene Lasioglossum costulatum, die Sägehornbiene Melitta haemorrhoidalis, die Löcherbienen Chelostoma campanularum, C. distinctum, C. fuliginosum, die Glanzbienen Dufourea dentiventris und D. inermis, die Mauerbiene Osmia mitis.
- Biotoptyp
- Weiden und Mähwiesen, Naturgärten, Wiesen (subsp. abietina: Steingärten)
- Verwendungshinweis
- Bienenweide auf Grünland; zweijährige Blume (subsp. abietina ist eine Staude) für gärtnerische Verwendung; aussaatwürdige Art für Blumenwiesen im Siedlungsbereich
- Zielgruppe
- Landwirte; Haus- und Kleingärtner; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen
- Zielgruppe Abkürzung
- L, H, K
- Nektar
- gut
- Pollen
- gut
- Blütenbesuchende Insekten
- Wird von Stelis minima und Stelis minuta als Nektarquelle genutzt.
- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen
- Sandbienen: Braunschuppige Sandbiene (Andrena curvungula) und Grauschuppige Sandbiene (Andrena pandellei), Osmia mitis, Glockenblumen-Sägehornbiene (Melitta haemorrhoidalis) und Chelostoma distinctum
- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen
- Andrena fulvida, Gewöhnliche Furchenbiene (Halictus tumulorum), Lasioglossum leucozonium, Salbei-Schmalbiene (Lasioglossum xanthopus), Zweifarbige Sandbiene (Andrena bicolor), Andrena florivaga und Lasioglossum pauxillum
Breunig, T. et al. (2021): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Global Biodiversity Information Facilty (GBIF). Online Publication: www.gbif.org; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Metzing, D. et al. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Trachaeophyta) Deutschlands .; Parreno, Alejandra et al. (2025): Visitation records of bees in Germany (58 plots). See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31131?version=12; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;
Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google
| Fundort | Datum (ISO) | Sammler oder Beobachter | Lat. | Long. | Projekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hohenheimer Gärten, Vegetationsgeschichte, Plot 27Deckungsgrad r | 2020-06-13 | Tim Beuter | 48,70804 | 9,21358 | Bachelorarbeit |