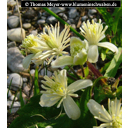Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)
Clematis vitalba L. 1753
Ranunculaceae
- Hahnenfußgewächse (APG IV)Gewöhnliche Waldrebe
Taxonkonzept: The Plant List (2014), version 1.1
Verbreitung: Europa ohne Scandinavien, Türkei, Zypern, Libanon, Kaukasus, Nord-Iran, Afghanistan, Algerien
Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN
Größe: 3 - 20 (m)
Blütezeit: VI - IX
Kurzbeschreibung: Ausdauernde Pflanze die lianenartig klettert. Stängel vierkantig, verholzend, im Alter auffasernd, linkswindend. Blätter gegenständig, unpaarig gefiedert mit langen Stielen, 3-5 Teilblätter ebenfalls gestielt, breit lanzettlich, am Grunde herzförmig, unregelmäßig gezähnt oder ganzrandig. Blüten in end- oder blattachselständigen, vielblütigen Rispen. Blüten bis 2,5 cm im Durchmesser, lang gestielt, zwittrig, unangenehm nach Weißdorn riechend. 4 weiße Perigonblätter, oval, beiderseits dicht flaumig behaart, abstehend bis zurückgebogen. Frucht abstehend behaart mit 2-3 cm langem Griffel. Die gewöhnliche Waldrebe ist eine europäische Pflanze die nordwärts bis Südengland, südwärts bis Südspanien und ostwärts bis in den Kaukasus vorkommt. Sie wächst in Auwäldern und Auengebüschen, an Busch- und Waldrändern, auf Waldlichtungen, in Hecken und Gebüschen. Sie bevorzugt frische, nährstoff- und basenreiche (meist kalkhaltige), humose, oft rohe, lockere, tonreiche Lehmböden.
Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei Zander 2008; Familie: Ranunculaceae (Zander 2008)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei The Plant List (2010); Familie: Ranunculaceae (APG III)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Ranunculaceae (APG III)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei Zander 2008; Familie: Ranunculaceae (APG IV)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei Schmeil-Fitschen 2019; Familie: Ranunculaceae (APG IV)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Ranunculaceae (APG IV)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Ranunculaceae (APG II)Clematis vitalba L. - Accepted: Clematis vitalba L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Ranunculaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))
- Blütenfarbe
- weiß
- Blüten
- Blüten radiär, zwittrig, lang gestielt, Blüten in reichblütigen Rispen, lang gestielt, Blütenhüllblätter (creme-)weiß, ausgebreitet, ~10 mm lang, 4 Perigonblätter, oval, weiß oder außen grünlich
- Schutzstatus, Rote Liste
- Ungefährdet in DE und BW (*)
- Lebensform
- holzig, Kletterpflanze/ Liane/ Winder
- Bodenbedingungen
- frische, nährstoff- und basenreiche, mild bis mäßig saure, humose, mehr oder weniger rohe, lockere, vorzugsweise tonige Lehmböden
- Lichtbedingungen
- Halblichtpflanze
- Lichtbedingungen (Symbole)
- ◐ - ○
- Sukzessiontypus
- Rohbodenkeimer, Pionierpflanze (Erstbegrüner, Bodenfestiger)
- Natürliches Vorkommen (Habitat)
- Auenwälder, vor allem an Busch- und Waldrändern, Waldverlichtungen, auch sonst im siedlungsnahen Gebüsch; vor allem Tieflagen, im Süden Deutschlands wird nord-östliche Verbreitungsgrenze erreicht
- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)
- ziemlich häufig und gesellig
- Kommentar zur Ökologie
- Stickstoffzeiger
- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)
- vor allem Auen- und Ruderalgebüsch, Prunetalia-Art, Ord. Prunetalia spinosae
- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen
- nicht salzertragend
- Einschränkungen bzgl. Temperatur
- etwas wärmeliebend
- Sicherheitshinweis
- giftig
- Status der Einbürgerung
- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota
- Chemische Merkmale
- Anemonin, Protoanemonin,Triterpensaponine, Stigmasterolglykoside
- Chemie und pharmzeutische Nutzung – kurz
- Herba Clematidis: Kraut
- Pharmazeutische Nutzung
- Das Kraut volkstümlich bei Gicht, rheumatischen Beschwerden und Hauterkrankungen wie Ekzemen. Die frischen Blätter in der Homöopathie zur Anwendung bei oberflächlichen Krampfadergeschwüren
- Kommentare
- Giftig, Saft hautreizend
- Generelle Empfehlung
- empfohlen für die Bienenweide
- Biotoptyp
- zum Überwuchern von Sträuchern, Baumstämmen, Mauern, auch in der Landschaft; Gehölzgruppen, Spaliere, Naturgärten
- Verwendungshinweis
- starkes Gerüst als Kletterhilfe an Mauern und Wänden erforderlich
- Zielgruppe
- Haus- und Kleingärtner; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen; Forstwirte, Jäger und Waldbesitzer; Imker
- Zielgruppe Abkürzung
- H, K, F, I
- Nektar
- keinen bis mittel
- Pollen
- mittel bis gut
- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen
- Gewöhnliche Schmalbiene (Lasioglossum calceatum) und Pförtner-Schmalbiene (Lasioglossum malachurum)
- Steckbriefe Wildbienen (www.Wildbienen.info.de)
- Steckbrief Lasioglossum calceatum
Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Karl Hiller et al. (2010): Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen.. Spektrum, Heidelberg, 2. Auflage 9783827420534.; Martin Nebel et al. (1990): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Band 1. 1. Eugen Ulmer, Stuttgart 3-8001-3309-1.; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.; WFO (2024): World Flora Online. Version 2024.06 Published on the Internet; http://www.worldfloraonline.org. Accessed on: 2024-12-20.;
Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google
| Geschlecht | Standort | Akzessions-Nr. | Pflanzjahr | Spende | IPEN | Lat. | Long. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzelle B | EG-B-037-21416 | 1990 | XX-0-HOH-EG-B-037-21416 | 48,7108267805 | 9,2071157085 |