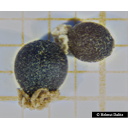Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)
Scilla bifolia L. 1753
Asparagaceae
- Spargelgewächse (APG IV)Zweiblättriger Blaustern
Taxonkonzept: Schmeil-Fitschen 2019
Verbreitung: Europa außer Britische Inseln und Skandinavien; Türkei, Syrien, Kaukasus
Größe: 0,05 - 0,2 (m)
Blütezeit: III - IV
Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei Zander 2008; Familie: Hyacinthaceae (Zander 2008)Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei The Plant List (2010); Familie: Asparagaceae (APG III)Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Hyacinthaceae ()Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asparagaceae (APG IV)Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei The Plant List (2010); Familie: Asparagaceae (APG IV)Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Asparagaceae (APG IV)Scilla bifolia L. - Accepted: Scilla bifolia L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Asparagaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))
- Blütenfarbe
- hellblau
- Blüten
- Perigonblätter frei oder <15% ihrer Gesamtlänge verwachsen, sternförmig ausgebreitet; Staubfäden abstehend, von gleicher Farbe wie das Perigon, Staubbeutel und Pollen weinrot bis blauviolett
- Schutzstatus, Rote Liste
- Ungefährdet in DE (*)
- Lebensform
- krautig, geophytisch
- Bodenbedingungen
- grund- und sickerfrische, nährstoff- und basenreiche, milde bis mäßig saure, humose, lockere, meist tiefgründige Lehm- und Tonböden, Mullböden
- Lichtbedingungen
- Halbschattenpflanze
- Lichtbedingungen (Symbole)
- ◐
- Natürliches Vorkommen (Habitat)
- Auenwälder, Auenwiesen, krautreiche Eichen- und Buchenwälder
- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)
- ziemlich selten aber gesellig; nach BNatSchG besonders geschützt (in Deutschland ungefährdet)
- Kommentar zur Ökologie
- Wärmezeiger, Feuchtezeiger, Stromtalpflanze
- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)
- geschützt oft mit Allium urs. u.a. Geophyten, im Alno-Ulmion oder feuchtem Carpinion, Tilio-Acerion und Fagion, auch in bodenfrischen Quercetalia pub.-Ges., Querco-Fagetea-Klassencharakterart,
- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen
- nicht salzertragend
- Status der Einbürgerung
- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota
- Kommentare
- Giftig
- Generelle Empfehlung
- Empfohlen für die Bienenweide
- Biotoptyp
- Gehölzgruppen
- Verwendungshinweis
- Zwiebel für gärtnerische Verwendung
- Zielgruppe
- Haus- und Kleingärtner; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen; Streuobstwiesenbewirtschafter
- Zielgruppe Abkürzung
- H, K, S
- Nektar
- mittel bis gut
- Pollen
- mittel bis gut
Dingermann, T. & Zündorf, I. (2013): Beschreibungen des Neuen Senckenbergischen Arzneipflanzengartens. Online: http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/ Neuer_Senckenbergischer_ Arzneipflanzengarten/index.html.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Frenzel, B. (2006): Heilpflanzen der Äbtissin Hildegrad von Bingen (1098 - 1179 n. Chr. im Botanischen Garten der Universität Hohenheim - ein Beispiel für den langen Gang medizinischer Erfahrungen und Hoffnungen. Hildegard von Bingen - und der Hohenheimer Heilpflanzengarten (Hrsg. Fellmeth, U.); Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; Schönfelder, P. (2011): Das neue Handbuch der Heilpflanzen.. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart: 502. 978-3-440-12932-6.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51;
Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google
| Geschlecht | Standort | Akzessions-Nr. | Pflanzjahr | Spende | IPEN | Lat. | Long. |
|---|